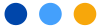
Wie Teams lernen können, offen über Diskriminierung zu sprechen – und warum Reflexion und Achtsamkeit dafür entscheidend sind
Diskriminierung macht auch vor dem Arbeitsplatz nicht halt – sie ist dort ebenso präsent wie in anderen Lebensbereichen. Trotzdem wird sie im beruflichen Kontext oft verdrängt oder tabuisiert.
Wie also können Organisationen Verantwortung übernehmen und Räume schaffen, in denen Diskriminierung sichtbar gemacht, angesprochen und bearbeitet werden kann? Was bedeutet es konkret, diskriminierungskritisch zu arbeiten? Und wie lassen sich Arbeitsorte gestalten, an denen Menschen sich gestärkt fühlen, ihre Emotionen zeigen dürfen und als ganze Personen wahrgenommen werden?
Über diese Fragen haben wir mit Ivan Felipe gesprochen. Er ist Trainer und Berater für Diversity und Antidiskriminierung und begleitet Teams und Organisationen in Berlin auf ihrem Weg hin zu mehr Achtsamkeit, Offenheit und Verantwortungsbewusstsein.

Was motiviert dich besonders, Teams und Organisationen in diskriminierungssensiblen Kontexten zu begleiten?
Ivan Felipe: „Mich treibt die Idee an, dass Arbeit nicht nur ein Ort für Leistung ist. Wir verbringen einen Großteil unseres Lebens dort – also sollte es auch ein Raum sein, in dem wir uns wohlfühlen und in dem unsere unterschiedlichen Realitäten respektiert werden.
Diskriminierung passiert überall, auch am Arbeitsplatz. Genau deshalb braucht es dort Räume, in denen diese Themen sichtbar gemacht und angesprochen werden können. Ein ‚professionelles Umfeld‘ darf nicht bedeuten, dass Emotionen oder Verletzungen unsichtbar bleiben.
Für mich geht es darum, Arbeitsorte so zu gestalten, dass Menschen sich gestärtkt fühlen und nicht auf eine Rolle reduziert werden. Auch im Job bringen wir unsere Emotionen, unsere Körper und unsere Geschichten mit – und das sollte nicht verdrängt, sondern als Teil unserer Ganzheit anerkannt werden. Es motiviert mich, wenn Menschen nicht nur zur Arbeit gehen, sondern an einen Ort, an dem sie als ganze Personen gesehen werden.“
Welche konkreten Schritte können Personen sofort ergreifen, wenn sie Diskriminierung oder Mikroaggressionen beobachten?
Ivan Felipe: „Zuerst: für die betroffene Person da sein. Das muss gar kein großer Auftritt sein. Manchmal reicht ein Blick, ein kurzes ‚Ich habe das gesehen‘ oder später die Nachfrage: ‚Wie geht es dir damit? Brauchst du Unterstützung?‘ oder auch ein Gespräch danach. Viele denken, sie müssten sofort eingreifen oder die Situation auflösen. Oft ist diese Form der emotionalen Unterstützung wichtiger als alles andere. Sie macht deutlich: Ich habe das gesehen. Du bist nicht allein.
Gleichzeitig ist es wichtig, sich klarzumachen: Wir alle können sowohl Diskriminierte als auch Diskriminierende sein. Das bedeutet, auch die eigenen Emotionen zu reflektieren – warum reagiere ich so, was macht mich wütend, wo handle ich verletzend oder sogar diskriminierend? Nur wenn es Räume für diese Auseinandersetzung gibt, wird es möglich, wirklich darüber zu sprechen.
Zugleich braucht es Strukturen in der Organisation: Räume, in denen Diskriminierung kein Tabu ist und in denen es sogar als Stärke gilt, offen über Emotionen und Verletzungen zu sprechen.“
Welche Strategien empfiehlst du, um Konflikte nicht eskalieren zu lassen, sondern konstruktiv zu bearbeiten?
Ivan Felipe: „Es beginnt bei der Organisation. Diskriminierung ist keine Meinung, – das muss klar benannt werden können. Beschwerden dürfen nicht als Bedrohung verstanden werden, sondern als Chance, Räume für Dialog und Veränderung zu schaffen.
Die Verantwortung liegt bei der Organisation. Sie muss Strukturen schaffen – etwa eine Kommission oder Anlaufstelle –, die zuhört, begleitet und den Prozess übernimmt. Wenn Menschen wissen, dass es solche Orte gibt, müssen sie nicht in jedem Moment selbst aushalten oder deeskalieren.
Dabei ist zentral: Der Fokus liegt immer auf der Person, die diskriminiert wurde oder eine Verletzung erlebt hat. Manchmal möchte sie gar keine Mediation oder Konfrontation, sondern einfach nur über das Erlebte sprechen und gehört werden. Auch das ist legitim und muss respektiert werden.
Das Ziel ist nicht eine diskriminierungsfreie Organisation – das wäre unrealistisch. Ziel ist eine diskriminierungskritische Organisation, die offen mit den eigenen Themen umgehen kann.“
Gibt es eine Art „Werkzeugkasten“ oder Methoden, die sich besonders bewährt haben, um in schwierigen Situationen angemessen zu reagieren?
Ivan Felipe: „Es gibt keinen universellen Werkzeugkasten, der für alle passt. Was ‚angemessen‘ ist, hängt stark von der Situation, von der Organisation, meiner Rolle und auch von mir als Person ab – ob ich selbst diskriminiert wurde oder ob ich merke, dass ich gerade diskriminierend gehandelt habe.
Für mich ist die wichtigste Methode, auf meinen Körper zu hören: Welche Emotionen sind da, und kann ich sie halten, bevor ich reagiere? Früher habe ich oft sehr schnell reagiert – rational oder abgegrenzt. Heute versuche ich, innezuhalten, Raum für meine Emotionen zu schaffen und erst dann zu handeln. Das macht meine Reaktionen klarer und verbundener.
Daneben sehe ich Organisationen in der Pflicht, Mitarbeitende durch Trainings zu unterstützen. Sensibilisierung, Körperarbeit und diskriminierungskritische Weiterbildung sollten genauso selbstverständlich sein wie fachliche Qualifikationen.“
Wie können Organisationen Strukturen oder Routinen einführen, die es allen erleichtern, diskriminierende Situationen anzusprechen?
Ivan Felipe: „Zuerst braucht es den Willen der Führungsebene. Wer behauptet, es gebe ‚keine Beschwerden‘, übersieht oft die Realität – das ist für mich eher ein Warnsignal. Umgekehrt zeigt eine Organisation, die offen über Beschwerden spricht: Hier wird das Thema ernst genommen.
Hilfreich sind feste Strukturen wie AGG-Beschwerdestellen, aber auch Routinen im Alltag. Check-ins in Meetings, Supervisionen mit diskriminierungskritischem Fokus oder Reflexionsräume bei Klausurtagungen machen es leichter, Diskriminierung anzusprechen.
Besonders wichtig wird das in Teams – etwa dort, wo migrierte und rassifizierte Teammitglieder arbeiten oder wo es deutliche Machtungleichgewichte gibt, zum Beispiel zwischen Männern und anderen Geschlechtern. Genau in solchen Konstellationen braucht es Supervisionen, die Diskriminierung explizit in den Blick nehmen.“
Wie berücksichtigst du die individuellen Erfahrungen von Teammitgliedern, wenn du Teams begleitest – und welche Tipps kannst du geben?
Ivan Felipe: „Der erste Schritt ist die Selbstreflexion: Wer bin ich in dieser Organisation? Welche Rollen und Identitäten bringe ich mit, welche Machtpositionen habe ich? Wir können unsere Biografie nicht einfach an der Bürotür ablegen – sie prägt, wie wir arbeiten und wie andere uns wahrnehmen.
Das wird besonders spürbar, wenn es um Unterschiede in Machtverhältnissen geht: zum Beispiel, wenn eine BIPoC-Person von einer weißen Führungskraft bewertet wird oder wenn Menschen mit Migrationserfahrung in einem Team mit überwiegend deutschen Kolleg:innen arbeiten. Diese Dynamiken beeinflussen den Alltag – und es ist wichtig, sie bewusst zu reflektieren.
Ein zweiter Punkt ist Sprache. Sprache wirkt, sie kann einschließen oder ausschließen. Schon kleine Verschiebungen machen einen Unterschied. Wenn eine Organisation sich etwa nur als ‚familienfreundlich‘ versteht, stellt sich die Frage: Was genau wird unter Familie verstanden? Sind alle Arten von Familien willkommen? Was bedeutet das für Menschen, die keine Familie in Deutschland haben oder keine Familie gründen möchten? Besser wäre es, von ‚lebensrealitätsfreundlich‘ zu sprechen.
Es geht darum, ehrlich über Machtverhältnisse zu sprechen – nicht, um immer neutral zu sein, sondern um Verantwortung für die eigene Position einzunehmen.“
Diskriminierungskritisches Arbeiten bedeutet, Betroffene in den Mittelpunkt zu stellen, Diskriminierung sichtbar zu machen und Räume zu schaffen, in denen Offenheit möglich und gefeiert wird.
Diskriminierung passiert überall – entscheidend ist, sie wahrzunehmen, darüber zu sprechen und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. So können Arbeitsorte entstehen, an denen Menschen als ganze, vielfältige Personen Platz finden.
——————————————
Ivan Felipe (er/ihm) ist Diversity- und Antidiskriminierungsberater. Er gestaltet (Un)Learning-Prozesse, in denen Verwundbarkeit, Mitgefühl und Verantwortung Raum haben. Als PoC, cis-Mann und Latinx-Migrant arbeitet er als Trainer, Moderator und Organisationsberater mit Fokus auf Rassismus und Migration – stets eingebettet in den Kontext sozialer Gerechtigkeit. Mit Expertise in Intersektionalität, Organisationsentwicklung und Design Thinking begleitet er öffentliche Verwaltungen, den privaten Sektor sowie Bildungseinrichtungen auf ihrem Weg zu kollektiver Fürsorge und diskriminierungskritischer Praxis. Derzeit leitet er das Projekt DiFair – Gerechter Zugang zu Dienstleistungen für Drittstaatsangehörige von BQN – Zentrum für Diversitätskompetenz und führt weitere Projekte als Freiberufler durch.




