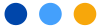
„Migrationshintergrund“ und „Integration“
Sprache prägt unsere Wahrnehmung. Sie spiegelt nicht nur gesellschaftliche Realitäten, sondern produziert sie auch aktiv mit. Begriffe wie „Migrationshintergrund“ und „Integration“ sind in öffentlichen Debatten, in der Medienberichterstattung und in der Praxisarbeit allgegenwärtig. Doch was sagen diese Wörter wirklich aus – und was bleibt dabei unsichtbar? Eine kritische Analyse zeigt: Diese Begriffe sind keineswegs neutral. Sie sind historisch gewachsen, gesellschaftlich aufgeladen und nicht selten Ausdruck struktureller Machtverhältnisse.

„Migrationshintergrund“ – ein statistischer Sammelbegriff mit ausgrenzender Wirkung
Ursprünglich wurde der Begriff „Migrationshintergrund“ vom Statistischen Bundesamt eingeführt, um Personen zu erfassen, die selbst oder deren Eltern nach Deutschland eingewandert sind. Damit sollte die Realität einer vielfältigen Gesellschaft sichtbar gemacht werden. Doch tatsächlich ist Gegenteiliges der Fall: in der Alltagsverwendung wirkt das Wort oft stigmatisierend. Unter dem Begriff „Migrationshintergrund“ vereinen sich extrem unterschiedliche Lebensrealitäten. Was haben eine aus Eritrea geflohene Person, die gezwungen war, ihre Heimat zu verlassen, und eine Person, deren Eltern sich entschieden haben, von Spanien nach Deutschland zu ziehen, gemeinsam? Vielleicht sehr viel – vielleicht auch kaum etwas. Dennoch subsumiert dieser Begriff beide Personen und spricht ihnen von außen Gemeinsamkeiten zu, ohne dass sie selbst für sich sprechen können.
Wenn wir von „Menschen mit Migrationshintergrund“ sprechen, meinen wir damit meist Menschen, die wir aufgrund optischer Merkmale als anders, beziehungsweise deren Sozialisation wir als anders wahrnehmen. Dieser Mechanismus wird „Othering“ genannt. Das bedeutet, dass eine bestimmte Gruppe – das vermeintliche „Wir“ – eine andere Gruppe oder Person als anders, fremd und nicht dazugehörig konstruiert, um sich selbst als Norm zu definieren. Differenzen werden dadurch hervorgehoben, eine Zugehörigkeit wird damit abgesprochen. Menschen werden auf ihre angenommene Herkunft reduziert, während ihre Potenziale, Erfahrungen und Wertevorstellungen unbeachtet bleiben.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass es sich bei dem Begriff um eine Fremdbezeichnung handelt. Das heißt, dass jene Personen, auf die sich der Sammelbegriff beziehen soll, ihn nicht selbst gewählt haben. Er wurde ihnen seitens des Statistischen Bundesamtes zugeschrieben.
„Integration“ – ein asymmetrischer Begriff mit kolonialem Erbe
„Integration“ gilt gemeinhin als das Ziel einer gelungenen Migrationspolitik. Wer sich gut integriert habe, sei in Deutschland angekommen und trage seinen Teil zur Gesellschaft bei – so die angenommene Vorstellung. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass der Begriff tief in einem einseitigen Verständnis von Anpassung verankert ist.
„Integration“ beschreibt den Prozess einzelner Personen, sich in eine vermeintlich homogene Gesellschaftsordnung einzufügen. Dabei werden verschiedene Dinge außer Acht gelassen: die Gesellschaft, in die sich migrierte Menschen einordnen sollen, ist keinesfalls einheitlich. Es gibt verschiedenste Subkulturen, die zum Teil konträre Werte vertreten. Darüber hinaus impliziert der Prozess, dass es allein seitens der „sich integrierenden“ Menschen einen Anpassungsprozess bedarf. Nicht thematisiert wird dabei, dass dieser Prozess nicht als Einbahnstraße verstanden werden kann. Alle Mitglieder einer Gesellschaft tragen Verantwortung dafür, dass sich die Menschen, die in ihr leben wertschätzend austauschen und in den Dialog treten, ungeachtet von Herkunft, Erfahrungen, sexueller Orientierung, Fähigkeiten, geschlechtlicher Identität, Alter und Religion.
Durch die scheinbar harmlose Aussage „die Person sei sehr gut integriert“ wird impliziert, dass es eine Instanz gäbe, die dies anhand bestimmter Merkmale messen und bestätigen könne. Im Allgemeinen sind damit Fragen zu Arbeit, Sprache, Freund:innenkreis, Freizeit gemeint. Wer einen deutschen Freund:innenkreis habe, spreche in der Freizeit Deutsch und sei gut integriert. Der Blick auf andere Eigenschaften bleibt somit verwehrt. Die Wertigkeit einer Person wird anhand impliziter Kriterien bemessen. Durch diese Bewertung kommen koloniale Machtasymmetrien zum Tragen.
Fazit: Sprache nutzen
Wörter wie „Migrationshintergrund“ und „Integration“ sind nicht falsch – gleichzeitig sind sie nicht neutral. Sie transportieren gesellschaftliche Vorstellungen von Zugehörigkeit, Normen und deren Abweichung. Wer spricht über wen – und wie – und warum? Wer definiert gängige Bezeichnungen und auf wen oder was beziehen sie sich? Was wird durch diese Begriffe sichtbar gemacht und was bleibt verborgen? Gibt es Alternativen, die mehr Gerechtigkeit und Selbstbestimmung fördern? Durch einen reflektierten und kontextualisierten Umgang mit Sprache können wir dazu beitragen, gängige Muster infrage zu stellen. Wichtig dabei ist, dass wir diejenigen, die wir ansprechen oder über die wir sprechen möchten, selbst zu Wort kommen lassen und offen sind für ihre Selbstbezeichnung und Kritik an verwendeten Termini. Denn Sprache ist nicht nur Medium – sie ist Macht. Und jene, die über Sprache entscheiden, erheben sich über jene, über die gesprochen wird.




