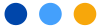
Wie Mikroaggressionen unsere Arbeitswelt und unser Miteinander beeinflussen
Diskriminierung zeigt sich in vielen Formen – manchmal offen, häufig aber auch verdeckt. Sie kann absichtlich oder unabsichtlich geschehen, direkt oder indirekt. Besonders schwer zu erkennen sind jene Formen, die vermeintlich positiv gemeint sind, dabei aber dennoch auf stereotypen Annahmen basieren. Solche oft beiläufigen, aber verletzenden Äußerungen nennt man Mikroaggressionen. Ihre Wirkung auf betroffene Menschen kann tiefgreifend sein – emotional, sozial und beruflich.

Mikroaggressionen – Was ist das?
Mikroaggressionen sind alltägliche Bemerkungen oder Handlungen, bei denen Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Diese Eigenschaften können subtile Diskriminierung in sich tragen, müssen jedoch nicht unbedingt negative Wertungen beinhalten, um verletzend zu sein. Auch scheinbare Komplimente, die aufgrund bestimmter Klischees geäußert werden, werden Mikroaggressionen genannt und können schmerzen. Denn durch stereotypisiertes Denken werden negative Zuschreibungen transportiert, auch wenn sie unausgesprochen bleiben. Durch Klischees werden diskriminierende Weltbilder reproduziert, die zu struktureller Diskriminierung beitragen. Besonders betroffen von Mikroaggressionen sind Menschen marginalisierter Gruppen sowie Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind.
Was können konkrete Beispiele für Mikroaggressionen sein?
Mikroaggressionen treten häufig in alltäglichen Situationen auf – oft unbeabsichtigt, aber dennoch mit verletzender Wirkung. Besonders deutlich wird dies, wenn vermeintlich neutrale oder sogar positiv gemeinte Aussagen stereotype Bilder transportieren. So haben Menschen, die mit Behinderungen leben, oft über Jahre hinweg individuelle Strategien im Umgang mit Barrieren entwickelt. Wird diese Selbstermächtigung als „inspirierend“ oder „motivierend“ bezeichnet, kann das zwar anerkennend gemeint sein – gleichzeitig wird dabei oft die vermeintliche „Andersartigkeit“ betont. Dies kann unbeabsichtigt andere Personen abwerten, die für sich andere Wege gefunden haben.
Auch im beruflichen Alltag zeigen sich Mikroaggressionen, etwa wenn bestimmte Personengruppen – zum Beispiel Frauen, Transpersonen oder queere Kolleg:innen – in Meetings wiederholt unterbrochen oder ihre Beiträge ignoriert oder weniger ernst genommen werden. Derartige Verhaltensmuster senden unterschwellige Botschaften über Wertigkeit und Zugehörigkeit und diskriminieren aufgrund sexueller oder geschlechtlicher Identität.
Ein weiteres Beispiel betrifft Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, denen – oft gut gemeint – vermittelt wird, sie hätten Glück, ihre berufliche Position zu haben. Aussagen wie „Wow, wie hast du denn diesen Job bekommen?“ mögen zunächst interessiert klingen, stellen bei genauerem Hinsehen jedoch die Qualifikation und Professionalität der angesprochenen Person infrage – insbesondere, wenn solche Kommentare wiederholt erfolgen.
Ein klassisches Beispiel für rassistische Mikroaggressionen ist die häufige Frage nach der Herkunft bei Menschen, die als „nicht deutsch“ gelesen werden. Auch wenn die Frage aus Interesse gestellt wird, enthält sie eine implizite Botschaft: Du gehörst nicht wirklich dazu. Für viele Betroffene ist das eine schmerzhafte Erfahrung, die Ausgrenzung spürbar macht.
Warum können Mikroaggressionen so verletzend sein?
Mikroaggressionen sind für Menschen, denen sie widerfahren, verletzend, da sie das Gefühl bekommen, aufgrund ihres äußeren Auftretens besondere Fähigkeiten zugeschrieben zu bekommen. Dadurch wird der Raum, über individuelle Kompetenzen ins Gespräch zu kommen, verengt. Wiederholte Fremdzuschreibungen können anstrengend und ermüdend sein. Betroffene Personen müssen sich aktiv entscheiden, ob sie die Zuschreibungen entkräften oder sie bewusst stehen lassen wollen.
So finden sie sich häufig in Erklärungs- oder Rechtfertigungssituationen wieder. Regelmäßig auf Hautfarbe, Sprache oder Herkunft angesprochen zu werden, ist erschöpfend und unterstellt eine vermeintliche Andersartigkeit – insbesondere, wenn ihnen die Gespräche aufgedrängt werden.
Welche Auswirkungen können Mikroaggressionen auf die Arbeit haben?
Auch am Arbeitsplatz kommt es zu Mikroaggressionen. Betroffene Personen berichten, dass sich Mikroaggressionen wie kleine Stiche anfühlen: jeder Stich für sich ist nicht so schmerzhaft. Viele Stiche zusammen führen zu einer nicht heilenden Wunde. Dies kann erhebliche Folgen für die betroffenen Personen sowie für das gesamte Team oder gar das Unternehmen haben. In der Summe wirken Mikroaggressionen massiv belastend und sind daher ein bedeutender Risikofaktor für Gesundheit, Motivation, Leistungsfähigkeit und die gesamte Unternehmenskultur.
Dass Vorurteile und Diskriminierung krank machen zeigt die Krankenkasse IKK classic. Sie hat 2021 eine rheingold Grundlagenstudie zur Wirkung von Vorurteilen und Diskriminierung im Alltag herausgegeben. Daraus geht hervor, dass Vorurteile und Diskriminierung neben sozialen auch gesundheitliche Probleme auslösen. „Die Folgen dieser Erfahrungen führen zu körperlichen und seelischen Symptomen: Diskriminierte erleben Gefühle der Unsicherheit, Irritation, Hilflosigkeit und sogar Scham und Schuld. Sie fühlen sich zudem allgemein weniger gesund und leiden häufiger unter Krankheiten“, so die IKK classic. Die Studie zeigt ebenfalls, dass von Diskriminierung betroffene Menschen häufiger an Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen Erkrankungen leiden. Dies hat eine direkte Auswirkung auf die Motivation und Produktivität.
Teams können nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen, Fehlzeiten und Fluktuation steigen und das Betriebsklima verschlechtert sich. Individuelle berufliche Erfolge können gehemmt und Karrierechancen verbaut werden. Langfristig gesehen hat Diskriminierung nicht nur Auswirkungen auf die Betroffenen, sondern kann auch die Problemlösungskompetenzen, Zusammenarbeit und Innovationskraft ganzer Organisationen schmälern.
Wie reagiere ich, wenn ich Mikroaggressionen beobachte?
Wenn Menschen über verletzende Erfahrungen sprechen, ist Zuhören der wichtigste erste Schritt. Entscheidend ist dabei: Nur die betroffene Person kann beurteilen, ob eine Aussage verletzend war oder nicht. Es ist nicht unsere Rolle, ihre Wahrnehmung infrage zu stellen.
Wenn eine Mikroaggression beobachtet wird, ist es sinnvoll, zunächst das Gespräch mit der betroffenen Person zu suchen. Gemeinsam kann geklärt werden, ob und wie Unterstützung gewünscht ist. Manchmal ist Konfrontation nicht der richtige Weg – manchmal schon. In jedem Fall gilt: Die Wünsche der betroffenen Person stehen im Vordergrund. Denn sie kennt ihre eigene Geschichte am besten.
Wenn eine direkte Ansprache sinnvoll erscheint, sollte diese in einer vertrauensvollen Atmosphäre und möglichst im kleinen Rahmen erfolgen. Statt Schuldzuweisungen helfen Ich-Botschaften und konkrete Erinnerungen an die Situation. Auch ein Gedächtnisprotokoll kann nützlich sein. Bei wiederholter Diskriminierung empfiehlt es sich, eine Beschwerde einzureichen oder eine Beratungsstelle wie das Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit einzubeziehen.
Warum geht uns das alle etwas an?
Mikroaggressionen wirken individuell verletzend – und gleichzeitig strukturell. Sie schwächen das Miteinander in Teams, behindern Chancengleichheit und verringern das Potenzial von Organisationen. Sie beeinflussen, wer sich zugehörig fühlt – und wer nicht. In einer vielfältigen Gesellschaft und Arbeitswelt, in der alle Menschen ihr Potenzial entfalten sollen, ist ein bewusster Umgang mit Sprache und Haltung unerlässlich.
Wer Mikroaggressionen erkennt, benennt und vermeidet, trägt dazu bei, dass sich alle Menschen sicher, respektiert und wertgeschätzt fühlen. Das stärkt nicht nur das Arbeitsklima, sondern auch das gesellschaftliche Zusammenleben.




